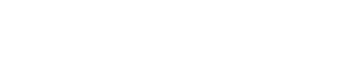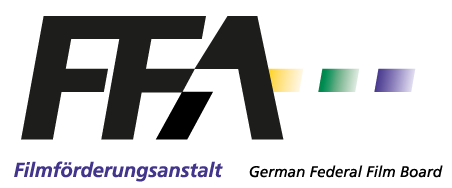Energiewende per Photovoltaik auf dem Gebäudedach
Am 1. Januar 2023 sind das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) und das Windenergie-auf-See-Gesetz 2023 (WindSeeG 2023) in Kraft getreten, nachdem sie Ende 2022 von der Europäischen Kommission genehmigt worden waren. Mit diesen Gesetzesnovellen sollen die Rahmenbedingungen für den Ausbau verbessert werden, um den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern.
Erreicht werden soll dies durch einen zügigen Ausbau der Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Im Bereich Photovoltaik wird mit Ausbauraten bis zu jährlich 22 Gigawatt bis 2030 eine installierte Leistung von insgesamt 215 Gigawatt angestrebt. Kräftig zulegen soll die Windenergie an Land mit 10 Gigawatt pro Jahr, um bis 2030 eine installierte Kapazität von rund 115 Gigawatt zu erreichen. Hinzu kommen sollen weitere 30 Gigawatt aus Offshore-Windenergie-Anlagen.
Um diese ambitionierten Zielsetzungen umzusetzen, enthält das EEG 2023 eine Reihe von Regelungen, die attraktivere Anreize für die Installation von Photovoltaik-Anlagen vorsehen. Diese reichen von einer festgeschriebenen höheren Einspeisevergütung über den Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen bis hin zur Bürgerenergie. Im Rahmen des WindSeeG 2023 sollen die Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzt und eine schnellere Beauftragung der Netzanbindung erreicht werden.
„Wir müssen den Ausbau beschleunigen. Denn es sind die erneuerbaren Energien, die längst zum Standortfaktor geworden sind“, erklärt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der bereits weitere Schritte angekündigt hat, um bürokratische Hemmnisse für die Photovoltaik- und die Windindustrie abzubauen. Bis Pfingsten sollen ein Entbürokratisierungsgesetz sowie ein Solarbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht werden.
Auch auf der europäischen Ebene haben sich die EU-Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt, was eine Vorfahrt bei Genehmigungen und Planungen erfordert. Die Europäische Kommission plant im Zuge der Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) eine europaweite Solardach-Pflicht einzuführen. Die im Rat vereinigten EU-Mitgliedstaaten hatten sich im Oktober 2022 darauf verständigt, dass künftig alle neuen Gebäude ihr Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie optimieren sollen.
Der Vorschlag der Kommission sieht vor, bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m² Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Im nächsten Schritt soll die Solarpflicht bis zum 31. Dezember 2027 auf alle bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 400 m2 ausgeweitet werden, die einer Renovierung unterzogen werden. Diese Regelung gilt somit auch für alle Kinos in der EU.
Das Forschungsteam des Öko-Instituts plädiert dafür, die europaweite Einführung einer PV-Pflicht vom dem 31. Dezember 2026 auf Ende 2024 vorzuverlegen. Die Wissenschaftler*innen haben im Auftrag des Climate Action Network (CAN) Empfehlungen formuliert, wie die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission noch wirkungsvoller gestaltet werden könnten. Diese beinhalten ab dem 31. Dezember 2024 die Solarpflicht schrittweise nach Gebäudetypen gestaffelt einzuführen. Auf diesem Wege könntem die benötigten Handwerker parallel zur schrittweisen Ausweitung der PV-Pflicht ausgebildet und die Infrastruktur für das Material aufgebaut werden, damit keine Personalengpässe und Spitzen für die Solarindustrie entstehen.
Zudem sollten alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet werden, möglichst günstige Bedingungen in ihrem eigenen Land zu schaffen, damit das gesamte Potenzial auf den Gebäudedächern für die Solarstromerzeugung ausgeschöpft werden kann. Bei einer Einführung der Solarpflicht am 31. Dezember 2024 hätten die Mitgliedsstaaten nach der geplanten Umsetzung auf EU-Ebene eineinhalb Jahre Zeit, die EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.