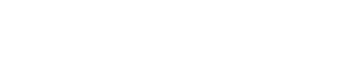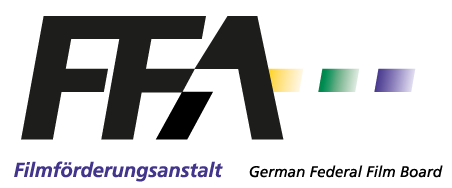BMWK-Werkstattbericht: Die Umsetzung der Wärmewende
Mehr als 80 Prozent des Wärmebedarfs von Gebäuden wird bisher durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt, auf die gut ein Viertel der CO2-Emissionen in Deutschland entfällt. Die Bundesregierung strebt bis 2030 an, mindestens die Hälfte der Wärme in Deutschland klimaneutral zu erzeugen. Bis 2045 sollen Gebäude nahezu vollständig mit Erneuerbaren Energien beheizt werden. Zur Umsetzung der Wärmewende hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) verschiedene Instrumentarien entwickelt. Dazu gehören Fördermaßnahmen zur Gebäudesanierung, die Wärmepumpenoffensive, der Ausbau grüner Wärmenetze sowie das Energieeffizienzgesetz, mit dem der Verschwendung kostbarer Energie ein Ende gesetzt werden soll.
Der aktuelle Werkstattbericht des BMWK gibt Aufschluss über die Gestaltung dieses Transfomationsprozesses. Die beiden zentralen Säulen, die dabei ineinander greifen, sind das Energiesystem und die industrielle Wertschöpfung. Um bis 2045 die im Bundesklimaschutzgesetz (KSG) festgelegten Klimaziele zu erreichen, muss sich das Tempo der Emissionsminderungen in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln und bis 2030 fast verdreifachen.
Nach den Emissionsdaten, die dem Umweltbundesamt für das Jahr 2022 vorliegen, sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent gesunken. Insgesamt wurden rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt, was eine Reduzierung um 15 Millionen Tonnen gegenüber 2021 bedeutet. Im Energiesektor sind mit rund 256 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten etwa 10,7 Millionen Tonnen mehr emittiert worden, was auf den vermehrten Einsatz von Stein- und Braunkohle zur Stromerzeugung zurückzuführen ist.
Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien ist gegenüber 2021 um neun Prozent angestiegen. Die Erneuerbaren Energien haben mit einem Anteil von 20,4 Prozent erstmals mehr ein Fünftel des gesamten Bruttoendenergieverbrauchs gedeckt. Bis 2030 werden in Deutschland 700 bis 750 Terawattstunden erneuerbarer Strom benötigt. Da dies eine Verdopplung der bisherigen Menge erfordert, kommt dem beschleunigten Ausbau von Wind und Photovoltaik eine entscheidende Rolle zu. Während der Energiesektor mit 257 Millionen Tonnen 2022 knapp seine Jahresemissionsmengen einhalten konnte, hat der Gebäudesektor die vorgesehenen Einsparziele nicht erreicht. Die Emissionen, die durch die Beheizung, Kühlung und Stromversorgung von Gebäuden entstehen, müssen gemäß dem Klimaschutzgesetz bis 2030 auf 67 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente reduziert werden.
Im Jahr 2022 sind durch den Gebäudesektor in Deuschland rund 112 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente freigesetzt worden.
Bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) liegt ein Schwerpunkt auf der Sanierung von Bestandsgebäuden. Die Sanierung eines schlecht sanierten Gebäudes zu einem Effizienzhaus wird mit einem zusätzlichen Bonus von zehn Prozent gefördert. Darüber hinaus gibt es einen 15-Prozent-Förderbonus für Serielles Sanieren. Das Bundesamt für Außenwirschaft (BAFA) hat 2022 im Bereich der systemischen Sanierung 2.200 Nichtwohngebäude unterstützt. Hinzu kommen Einzelmaßnahmen wie eine Sanierung der Gebäudehülle und die Installation von Wärmepumpen. 2022 sind in Deutschland mehr als 230.000 Wärmepumpen verkauft worden, was einer Steigerung von über 50 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Auch diverse Filmtheater setzen bereits auf Wärmepumpen und beziehen den dafür erforderlichen Strom aus der hauseigenen Photovoltaikanlage.
Für 2023 rechnen die Hersteller mit mehr als 350.000 Installationen und ab 2024 sollen mindestens 500.000 Wärmepumpen pro Jahr eingebaut werden. Dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) zufolge fehlen im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 15.000 Fachkräfte. Bislang sind nur rund 15 Prozent der Betriebe in der Lage, Wärmepumpen zu installieren. Deshalb startet das BMWK im April die Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe (BAW), um ausgebildete Fachkräfte in Handwerksbetrieben, Planungsbüros sowie Energieberatende zu fördern, die eine Fortbildung zum Einbau von Wärmepumpen absolvieren.
“Die ökologische Transformation ist bereits ein harter Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor”, konstatiert das BMWK in seinem Werkstattbericht. Im Jahr 2021 haben Industrieunternehmen rund 3,4 Mrd. Euro in den Klimaschutz investiert, um die Dekarbonisierung ihrer Produktion voranzutreiben. Die Anzahl der Beschäfigten, die mit den Investitionen zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand verbunden sind, lag im Jahr 2020 bei rund 540.800 Personen. Allein im Bereich der Erneuerbaren Energien waren 2021 rund 350.000 Personen beschäftigt, während nur noch rund 20.000 Personen im Kohlebereich gearbeitet haben.
Die Umsetzung des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Die Bundesregierung hatte bereits im Frühjahr 2022 angekündigt, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Diese Vorgaben sind in den Referentenentwurf zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eingeflossen, den das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium und das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) gemeinsam mit Stakeholdern von Immobilien-, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie Wärmepumpenherstellern erarbeitet haben. Um den Anforderungen der Praxis gerecht zu werden, sind zahlreiche Ausnahmen, Übergangslösungen und -fristen vorgesehen.
Im städtischen Bereich kann die Dekarbonisierung der dezentralen Wärmeerzeugung durch mehr klimaneutrale Fernwärme vorangetrieben werden. Eine effiziente Wärmeversorgung von Verbrauchern mit Erneuerbaren Energien erfordert entsprechende Wärmenetze. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) setzt Anreize für den Neubau von Wärmenetzen mit mindestens 75 Prozent Wärmeeinspeisung aus Erneuerbaren Energien und Abwärme. Die Nutzung von Abwärme ist auch ein zentrales Element im Energieeffizienzgesetz, mit dem das BMWK erstmals einen übergreifenden Rechtsrahmen zur Energieeinsparung schafft, um den Primärenergieverbrauch zu reduzieren.